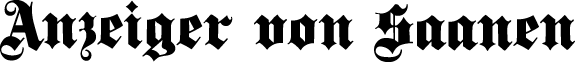Der Ruf der Freikirchen
03.06.2022 RegionVier von fünf Sanerinnen und Saanern gehören einer Landeskirche an. Das ist die grosse Mehrheit. Aber jede zwanzigste Person ist Teil einer der sieben Freikirchen oder der Sekte Zeugen Jehovas. Wie funktionieren Freikirchen?
BLANCA BURRI
Die Mehrheit der Saaner ist reformiert oder katholisch sozialisiert, also Teil einer Landeskirche. Zwar zählen viele zu den sogenannt Distanzierten, die der Institution Kirche angehören, aber keinen persönlichen Bezug mehr zu ihr pflegen. Die Bibel liegt nicht mehr auf dem Nachttisch. Die persönliche Beziehung zu Gott wird nicht mehr in der Kirche gelebt. An hohen Feiertagen besucht man ab und zu den Gottesdienst. Aus diversen Gründen: Weil es feierlich ist, weil man harmoniebedürftig ist oder den Kindern die Kirche zeigen möchte. Eine Rolle spielt die Kirche auch bei grossen Lebensereignissen wie Geburt (Taufe), Ehebund (Hochzeit) oder Beerdigung. Man glaubt vielleicht an eine höhere Macht, findet etwas Mystisches beim Yogaritual oder wenn man an einem Bergsee sitzt. Aber die wenigsten Personen setzen sich noch mit Allmachtsgestalten wie Gott oder Jesus auseinander. Das sieht in Freikirchen anders aus.
Hinter vorgehaltener Hand
Immer wieder hört man Geschichten über Freikirchen, die einen zum Staunen bringen. Beispielsweise, dass viele private Dinge dort besprochen werden und dass man sich gegenseitig hilft, obwohl das vielleicht gar nicht erwünscht ist und gar als übergriffig erlebt wird. Deshalb spricht die Gesellschaft oft hinter vorgehaltener Hand über Freikirchen. Man kann sich nicht vorstellen, wie man in einem so kontrollierten Umfeld glücklich werden kann. Manchmal hört man auch von Praktiken, die für Mitglieder der Landeskirchen ungewohnt sind, oder dass Freikirchler für den Gottesdienst von zu Hause abgeholt werden, wenn sie zwei-, dreimal gefehlt haben. Man ist unsicher, ob solche Praktiken in den Freikirchen an der Tagesordnung sind und ob die Mitglieder darunter leiden. Hinzu kommen Fragen wie: Kann man aus der Freikirche überhaupt austreten? Wird man dann stigmatisiert? Haben die Prediger eine Ausbildung oder verkünden sie ihre persönliche Ansicht?
Was suchen Menschen in einer Freikirche?
Anders als viele Mitglieder der Landeskirchen suchen Freikirchler eine Beziehung zur Gemeinschaft, den sogenannten Glaubensgeschwistern, und zu Gott. Deshalb praktizieren sie den Glauben aktiv. Sie suchen im Gebet, in der Bibel und in der Gemeinschaft Antworten auf Lebensfragen und auf das Weltgeschehen. Damit dies ausgelebt werden kann, bieten die Freikirchen den nötigen Raum in Gottesdiensten und vielen weiteren Formaten an, wo sich die Mitglieder austauschen und im Glauben wachsen können: Weiterbildungen, Diskussionsrunden über den Glauben und die Bibel, Gebetsstunden, Singabende, Lobpreisabende und vieles mehr.
Lobpreisungen im Popformat
Die Mitglieder feiern den Gottesdienst oftmals fröhlich und ausgelassen, vor allem in den sogenannten charismatischen Freikirchen. Popmusik umrahmt die mitreissenden Predigten. Die Bands, deren Mitglieder aus den eigenen Reihen stammen, spielen meist live. In den Songtexten geht es um die persönliche Beziehung zu Gott, dessen Verehrung und die Nächstenliebe. Ein ehemaliges Mitglied erzählt: «Wir haben im Sonntagsgottesdienst unsere Beziehung zu Gott gestärkt.»
Bibel lesen und füreinander Beten
Mehr über die evangelisch-freikirchlichen Normen und Werte ist im Buch «Phänomen Freikirche» von vier Wissenschaftler:innen zu erfahren. Dort steht: «Freikirchler sind nicht nur fleissige Gottesdienstbesucher, sondern auch fleissige Bibelleser.» Das Bibellesen sei im Tagesablauf eingebettet, beispielsweise lese man sie vor dem Zubettgehen. Die Freikirchler suchten in der Bibel Antworten auf Alltags- oder Lebensfragen. «Die Bibel gilt als Medium, durch das Gott zu seinen Gläubigen spricht», schreibt die Wissenschaftlerin Emanuelle Buchard.
Ein zweites wichtiges Glaubenselement ist das Gebet. Die Freikirchler beten, «um Gottes direktes Eingreifen entweder in den Gang der Welt im Allgemeinen, oder aber in persönlichen Situationen» zu erbitten, schreibt die Autorin weiter. Ein praktizierender Christ sagt: «Wir beten, haben unsere Rituale und versuchen, gute Gedanken zu schicken. Wir treten mit Gott in Dialog, fragen ihn auch mal um Rat.» Man kann also sagen, dass Mitglieder von Freikirchen gerne einer verbindlichen Gemeinschaft angehören und den Glauben lebendig und aktiv praktizieren. Sie finden darin ihr Seelenheil.
Verbindliche Gemeinschaft
Wer einer Freikirche angehört, sucht neben der Beziehung zu Gott auch eine soziale und emotionale Nähe zu den anderen Mitgliedern. «In einer Freikirche fühlt man sich gegenseitig verantwortlich und schaut zueinander», sagt ein ehemaliges Mitglied, das anonym bleiben möchte. Professor Martin Sallmann von der Universität Bern erklärt, dass dies viele Vorteile habe, weil sich die Mitglieder gegenseitig stützten und nicht nur in freudigen Momenten, sondern auch bei schwierigen Lebensereignissen füreinander da seien.
Gefahr der Vereinnahmung
Die Gefahr bestehe indes, dass einzelne Mitglieder vereinnahmt würden, weil sie einer ständigen sozialen Kontrolle ausgesetzt seien, so Sallmann. Es gibt viele Schattierungen von Vereinnahmungen und Sallmann betont, dass nicht jede Freikirche davon betroffen sei. Zudem kennt er die konkrete Wertehaltung der Freikirchen im Saanenland zu wenig, um zu beurteilen, ob darin Gefahren lauerten oder im Gegenteil eine gesunde Art des Glaubens vorhanden und ein freiheitliches Denken erlaubt seien.
Einzig bei den Zeugen Jehovas seien die Tendenzen zur Vereinnahmung gross. Die Zeugen haben in Zweisimmen und Château-d’Oex eine Niederlassung. An den Standorten praktizieren insgesamt 67 Personen. Die Zeugen Jehovas sind weltweit als Sekte bekannt. Bei ihr muss man davon ausgehen, dass die Mitglieder die vorgegebenen Werte eins zu eins übernehmen und praktizieren müssen. Wenn nicht, müssen sie mit Konsequenzen rechnen oder werden ausgeschlossen.
Wie kann es so weit kommen?
Die Freikirchenmitglieder verbringen viel Zeit miteinander. Einerseits an den religiösen Veranstaltungen wie Gottesdienst oder Bibelstunde, aber auch privat: «Da die Gemeinschaft klein ist, kennt man sich gut. Man vertritt dieselbe Wertehaltung und fühlt sich in einem verpflichtenden Umfeld wohl», sagt Martin Sallmann. Deshalb sässen Freikirchler auch nach der Predigt zusammen oder sie träfen sich unter der Woche in Gesprächsgruppen, an Seniorennachmittagen, zu Musikproben oder, um die Freizeit zusammen zu gestalten. Besonders stark sind die Freikirchen in der Jugendarbeit, die neben der Glaubensvermittlung eine grosse Portion Abenteuerfeeling im Freien verspricht. Einige Freikirchen bieten auch einen Kinderhort an. Durch die gemeinsamen Aktivitäten wird die soziale Kontrolle gross. Man kennt die Geheimnisse des anderen und bemerkt, wenn er einmal nicht zum Gottesdienst kommt.
In den Medien
In den Medien sind Freikirchen und Sekten immer wieder ein Thema. In den Beiträgen werden vor allem Missstände aufgedeckt. Wie bereits erwähnt, stehen in diesen Beiträgen die Vereinnahmung und Einschränkung des eigenen Willens oft im Brennpunkt. Aber auch: Bekehrungsrituale, Ausschluss aus der Gemeinschaft, wenn jemand eine kritische Haltung einnimmt, und sogar Teufelsaustreibungen. Die Teufelsaustreibung ist besonders umstritten. Viele Freikirchler glauben, dass man von Satan vereinnahmt werden kann. Eine Familie aus dem Saanenland sprach im Bauerntag 2020 offen darüber, wie ihre Tochter von Satan besetzt worden sei. Ist es nicht bedenklich, dass im 21. Jahrhundert einer kranken Tochter der stationäre Aufenthalt in einer Spezialklinik verwehrt wird und stattdessen Gott um Heilung angebetet wird? Solche Entscheidungen erschrecken die Öffentlichkeit. Das Video ist auf Youtube verfügbar.
Freikirche oder Sekte?
Da stellt sich sofort die Frage, ob solche Praktiken sektiererische Züge haben. Wesentliche Merkmale von sektiererischen Gruppierungen sind laut Martin Sallmann starke Abgrenzungen nach aussen, Abwehr von abweichendem, eigenständigem Denken oder ein dualistisches Welt- und Menschenbild. Doch ab wann gilt eine Religionsgemeinschaft als Sekte? «Das ist nicht so einfach zu beurteilen», gibt der Uniprofessor Auskunft und versucht einen Hinweis zu geben: «In der Regel kommen unterschiedliche Faktoren zusammen und verdichten sich. Beispiele sind die exklusive Vereinnahmung der Gläubigen für die Gemeinschaft, die Isolation der Mitglieder von familiären oder freundschaftlichen Beziehungen, die autoritäre Führung der Gruppe oder Ablehnung kritischer Haltungen gegenüber den Ideen und Werten der Gruppe.»
Die Vereinnahmung hat ein ehemaliges Mitglied zwar am eigenen Leib erlebt, gibt sich aber selbst die Schuld dafür: «Ich suchte jemanden oder etwas, der oder das mir sagt, wie ich leben soll, damit ich das Leben richtig lebe.» Die zitierte Person war im freikirchlichen Milieu besonders aktiv. Sie bemerkte erst später, dass sie sich hat vereinnahmen lassen und die Freikirche letztlich vor die Familie gestellt hat. Das gab Spannungen in der Ehe. Irgendeinmal wurde sich diese Person ihrer Abhängigkeit bewusst und trat aus der Freikirche aus. Ihr sind aber zwei Aspekte wichtig: Nicht alle Freikirchenmitglieder hätten die Tendenz zur Abhängigkeit oder Hörigkeit. Viele hätten ihre kritische Haltung nämlich bewahrt. Dabei handle es sich um langjährige und gut integrierte Freikirchenmitglieder. Der zweite Aspekt: Nach dem Austritt erfuhr die Person keine Repressalien. Noch immer pflegte sie einen schönen Austausch mit den Freikirchlern.
Ausbildung der Prediger ist umstritten
Die Landeskirchen hinterfragen, dass die Prediger in den Freikirchen oftmals keinen theologischen oder universitären Abschluss haben. In den Freikirchen predigen viele Laien:
• Ausgewählte und Freiwillige ohne Ausbildung (Christliche Versammlung Saanenland)
• Menschen mit einer internen Ausbildung (Heilsarmee)
• Ausgewählte und Freiwillige mit einzelnen Ausbildungsmodulen im Gebrauch der Bibel, Präsentation, Gesprächsführung, Argumentation und Bibelgeschichte (Jehovas Zeugen)
• Ausgewählte mit Bibelschuloder Jüngerschaftsausbildung (Möser Church)
• Laienprediger werden angehalten, sich intensiv mit den kircheneigenen Unterlagen und der Bibel zu beschäftigen (Neuapostolische Kirche).
• Laien und Theologen (Christliches Begegnungszentrum Gstaad)
Der Einsatz von Laienpredigern birgt Chancen und Gefahren. In Zeiten von Personalmangel, auch in den etablierten Kirchen, sind Laienprediger erwünscht, weil sie Lücken füllen und damit eine Gemeinschaft zusammenhalten. Für Laienprediger scheint der Austausch und das Abgleichen des Inhalts mit anderen Personen und Institutionen wichtig. Die Gefahr besteht nämlich, dass Laienprediger nicht fundiertes Wissen verbreiten und ihre Position missbrauchen, eigene Theorien unter die Leute zu bringen, was wieder zu sektiererischen Zügen führen kann.
Austritt mit Hürden
Bei den Landeskirchen ist ein Kirchenaustritt sehr einfach möglich. Ein unterzeichnetes Austrittsgesuch reicht, um alles Nötige in die Wege zu leiten. Bei den Freikirchen ist es mit dem Austritt unterschiedlich. Ein schöner Brauch findet in der Möser Church statt: «Wer gehen möchte, wird gesegnet und ziehen gelassen.» Bei der christlichen Versammlung gibt es keine Mitgliedschaft und somit muss der Austritt nicht formell erfolgen. Bei den Neuapostolischen Christen und im CBZ reicht wie bei den Landeskirchen ein Austrittsschreiben. Beim EGW gibt es nach der Schriftlichkeit ein persönliches Gespräch und die Heilsarmee beschränkt sich auf das Persönliche. Die Zeugen Jehovas deklarieren in der Umfrage selbst, dass bei einem Austritt «mit Veränderungen der sozialen Beziehungen gerechnet werden muss». Bevor es so weit kommen kann, müssen die Austrittswilligen Zeugen ein Austrittsschreiben verfassen und zu einem Gespräch antreten.
Für viele Menschen ist ein persönliches Gespräch mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Deshalb versuchen sie, ein Gespräch über ein so heikles Thema zu vermeiden und zögern einen Kirchenaustritt hinaus. Andere Personen lassen sich beim Gespräch wieder umstimmen und verbleiben in der Kirche.
Chance oder Gefahr?
Sieben Freikirchen, drei Landeskirchen und eine Sekte im kleinen Saanenland. Ist das eine Chance oder eine Gefahr? «Es kann die Auseinandersetzung mit dem Glauben bereichern», räsoniert Sallmann. Er begründet dies wie folgt: «Man muss sich bei so vielen etablierten Kirchen und Freikirchen immer wieder neu miteinander auseinandersetzen. Die religiöse Pluralität fordert, dass man sich austauscht, anpasst und voneinander lernt.» Gefährlich werde es, wenn eine Kirche überhandnehme und dadurch extreme Züge annehme. Diese Gefahr besteht im Saanenland derzeit nicht, auch wenn die Kirchen im Aufbruch sind. Aber das ist ein anderes Thema.
Die Fakten basieren auf einer Umfrage des «Anzeigers von Saanen» bei den Kirchen im Saanenland, dem Gespräch mit Prof. Dr. Martin Sallmann, Universität Bern, dem Bundesamt für Statistiken sowie dem Buch «Phänomen Freikirche» von den vier Religionswissenschaftlern Jörg Stolz, Olivier Favre, Caroline Gachet und Emmanuelle Buchard.
WAS IST EINE SEKTE?
Unter bestimmten Bedingungen können sich Gruppen – vom kleinen Therapiezirkel bis zum Welt umspannenden Unternehmen – zu sektenartigen Milieus entwickeln, die sich gegen aussen abgrenzen.
Sektenartige Gruppen überschätzen meist ihre eigene Bedeutung für die Welt und die Menschheit und neigen deshalb zu starkem Missionieren. In seltenen Fällen sind Gruppen von Anfang an als sektenhafte Milieus geplant. Häufiger ist die problematische Struktur das Ergebnis einer schleichenden Entwicklung.
Gruppen lassen sich nicht einfach den beiden Kategorien «Sekte» oder «Nicht-Sekte» zuordnen. Sektenartige Gruppen weisen Sektenmerkmale in unterschiedlicher Anzahl und Ausprägungen auf. Die Einschätzung einer Gruppe muss sich deshalb auf kritische Analysen, die Erfahrungen von Betroffenen und das Selbstverständnis der Gruppe stützen, und immer wieder auf ihre Aktualität hin überprüft werden. Diese Betrachtung hinsichtlich problematischer Aspekte und Konfliktfelder nähert sich dem Phänomen besser an als die Label «Sekte» und «Nicht-Sekte».
Quelle: www.infosekta.ch