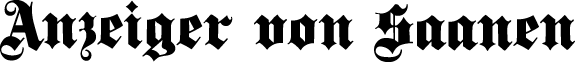Was Tretmühlen, Stadion und Froschteich mit Glück zu tun haben
17.08.2021 KulturAm Sonntagmorgen ist zum vierten Mal das Gstaad Forum für Kultur mit einem Panel von drei hochkarätigen Persönlichkeiten aus den Disziplinen Politik, Ökonomie und Theologie unter der Moderation von Norbert Bischofberger über die Bühne gegangen. Vor einem zahlreichen Publikum debattierten sie im Park Gstaad darüber, welche Voraussetzungen nötig sind, damit Menschen glücklich sind. Dabei kamen auch originelle Ansätze und Lösungsvorschläge zutage.
MARTIN GURTNER-DUPERREX
«Ich distanziere mich vom kurzfristigen, emotionalen Glücksbegriff», meinte die Berner SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen auf die einführende Frage von Dr. Norbert Bischofberger, Moderator und Redaktor beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF, ob die eingeladenen Gäste des Gstaad Forums für Kultur ein glückliches Leben führten. Zufriedenheit sp üre sie, wenn sie durch die Politik dazu beitragen könne, das Leben der Menschen langfristig zu verbessern. Ähnlich sah es der Jesuitenpater und Theologe Franz-Xaver Hiestand. Ihm sei wichtig, ein Teil eines Kollektivs zu sein, das dazu beiträgt, das Leiden anderer Menschen zu lindern, anstatt individuelle Glücksmomente zu suchen.
Dr. Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen, ist hingegen überzeugt, dass Glück «eine Mischung aus kleinen Glücksmomenten und langfristiger Zufriedenheit im Leben ist».
Das Glück und die Wissenschaft: Deutschweizer glücklicher als die Welschen?
«Die Wissenschaft weiss nicht genau, was Glück ist», betonte der schweizweit bedeutende Ökonom Mathias Binswanger. «Es gibt keine objektiven Messgeräte, um zu messen, ob Menschen glücklich sind.» Nach den «Happiness Reports» sei die Schweiz immer eines der glücklichsten Länder der Welt. Aber man begegne hier trotzdem nicht nur lachenden und fröhlichen Menschen. Interessant findet er auch, dass die Deutschschweizer öfter angeben, glückliche Menschen zu sein als die Westschweizer oder Tessiner. «Allgemein liegen im internationalen Glücksranking jeweils nordische protestantische Länder wie Finnland, Norwegen oder Schweden ganz vorne», so der Volkswissenschaftler. «Während die katholischen Länder wie Italien sich eher gerne beklagen», fügte er nicht ohne Schalk hinzu. Dies habe aber weniger mit wirtschaftlichen Problemen zu tun oder damit, dass sie weniger glücklich wären, sondern vielmehr mit Mentalität.
Das Glück und die Politik: breite Abstützung nötig
«Der Antrieb jedes Politikers ist, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen», stellte die ausgebildete Politologin Flavia Wasserfallen fest. Es brauche aber Gleichgesinnte und Verbündete aus anderen Parteien, um gemeinsam Lösungen zu finden, die von allen akzeptiert würden.
Damit Vertrauen in die staatlichen Institutionen geschaffen werden könne, müsse die Politik bei der Bevölkerung breit abgestützt sein. So können trotz unterschiedlicher Meinungen Problemlösungen durch Debatten und Abstimmungen gefunden werden.
«Das Messen von mehr Produktivität, Einkommen und Wohlstand sagt wenig aus über die Zufriedenheit der Menschen», ist die Politikerin überzeugt. Andere messbare Indizien wären hingegen die psychische Gesundheit, Abhängigkeit von Medikamenten, Depressionen, häusliche Gewalt, Jugendgewalt … «Gerade bei den Jugendlichen hat die Politik während der Pandemie versucht, die Einschränkungen so massvoll wie möglich zu halten», zeigte sie als konkretes Beispiel auf. So seien in der Schweiz die Schulen am wenigsten lang geschlossen geblieben im Vergleich mit anderen Ländern. Das war ihrer Meinung nach wichtig, weil sonst die Gefahr bestanden hätte, dass die Ungleichheit zunimmt, auch bei der Lehrstellensuche. In der Gesundheitsdiskussion des Nationalrats habe man durchaus über die psychische Gesundheit und die Folgen von Long Covid auch bei Jugendlichen gesprochen und mit dem Bund und den Kantonen nach Lösungen gesucht.
Das Glück und das Geld: die Tretmühle
Kann Geld glücklich machen? Diese Frage konnte Mathias Binswanger nicht mit Ja oder Nein beantworten. Er bezog sich aber auf sein Buch «Tretmühlen des Glücks»: Auf einer Tretmühle im Fitnessstudio könne man immer schneller rennen, bleibe aber an Ort und Stelle. «Indem wir ständig einem höheren Einkommen nachrennen, bleiben wir glücksmässig ebenfalls auf der gleichen Stelle», so Binswanger.
Man stelle nämlich fest, dass ein höheres Einkommen nicht zu mehr Glück führe, wenn einmal die grundsätzlichen Bedürfnisse gedeckt sind. Andererseits sei aber doch erwiesen, dass die Reichen glücklicher sind als die Armen. Er erklärte diesen anscheinenden Widerspruch auf folgende Weise: Ein kleiner Zuschauer im Stadion steht auf, weil er vom Fussballspiel nichts sieht. Nun stehen alle anderen auch auf, um ihrerseits besser sehen zu können. Am Schluss stünden zwar alle auf einem höheren Niveau, aber die Situation bleibe die gleiche wie vorher: «Die Grossen sehen gut, die Kleinen schlecht – und in Wirklichkeit hat sich die Gesamtsituation sogar verschlechtert, weil jetzt alle stehen müssen», schloss er die Gleichung. So würden die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft durch besseres Einkommen nicht glücklicher, weil es auf höherem Niveau ebenfalls immer ansteige – «ein Nullsummenspiel ohne Ende».
Das Glück und die Globalisierung: der Froschteich
Kritiker der «Tretmühlen des Glücks» wiesen zu Recht darauf hin, dass ohne Wachstum kein Wohlstand möglich ist. Ein gutes Beispiel sei Griechenland, das zwischen 2008 und 2013 kein wirtschaftliches Wachstum aufweisen konnte und schliesslich eine Arbeitslosenrate von 30 Prozent aufwies. «Wir leben im unlösbaren Dilemma, dass unser globales Wirtschaftssystem darauf ausgerichtet ist, immer weiterzuwachsen – mit den entsprechenden Kollateralschäden für die Umwelt», beklagte Mathias Binswanger.
Wie könnte Mathias Binswangers Falle der Tretmühle umgangen werden? «Ein grosser Frosch in einem kleinen Teich fühlt sich glücklicher und wichtiger als ein kleiner Frosch in einem grossen Teich», gab er zur Antwort. Es gehe darum, für sich die richtige Teichgrösse zu finden, denn es sei besser, ein «local hero» zu sein als ein «global looser».
Auch Flavia Wasserfallen besinnt sich gerne zurück auf Kleinräumiges, Lokales, auf Biogemüse vom Bauernhof, anstatt Pouletfleisch aus Brasilien zu konsumieren. Sie wünsche sich ein grösseres Bewusstsein bei den Konsumentinnen und Konsumenten. «Es wäre aber falsch, die Grenze zu schliessen», warnte sie, denn die grossen Probleme könnten nur global angegangen werden. Sie wies darauf hin, dass die Wirtschaft wieder dem Menschen dienen müsse und nicht umgekehrt – dass die Arbeit den Menschen erfüllen sollte, anstatt ihn krank und unglücklich zu machen.
Das Glück und die Lösungsuche: «Ds Füfi u ds Weggli»
Franz-Xaver Hiestand zitierte als Lösungsvorschlag die deutsche Theologin Dorothee Sölle, wonach Jesus der glücklichste Mensch gewesen sei, weil er aufgehoben war in einem grossen Leben. «Es ist die gleichzeitige Haltung des Empfangens und Gebens, die die nötige Kraft gibt, in einer grösseren Dynamik zu wirken und Glück zu schaffen», ist seine Überzeugung. Flavia Wasserfallen griff die Wichtigkeit der Gleichheit auf. Wo es weniger Ungleichheiten gebe, seien die Menschen glücklicher, weil das Glück in Verbindung zu anderen stehe. «Mein Leitgedanke war immer, daran mitzuarbeiten, dass es weniger Ungleichheiten gibt», betonte sie. Neun Prozent der Menschen in diesem Land lebten an der Armutsgrenze – was «hier in Gstaad nicht unbedingt sichtbar ist, anderswo aber schon».
Mathias Binswanger schlussfolgerte, dass es ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit brauche. Die meisten zögen jene Formel vor, die vergleichbar ist mit «der Freiheit im Gehege, wo man frei und sicher herumrennen kann, ohne in der Wildnis draussen leben zu müssen». Es scheint, dass dies den Schweizer, der so «ds Füfi u ds Weggli» kriegt – wie es Binswanger ausdrückte –, zum glücklicheren Menschen macht.
Damit nahm diese spannende Ausgabe des Gstaad Forums für Kultur unter dem Leitspruch von Aristoteles «All unser Streben ist ausgerichtet auf ein glückliches Leben» doch noch ein glückliches Ende, was das zahlreich erschienene und interessierte Publikum nicht daran hinderte, bei der anschliessenden Fragerunde und während des offerierten Apéros weiter über das Glück und Unglück des Menschen zu debattieren und zu philosophieren.